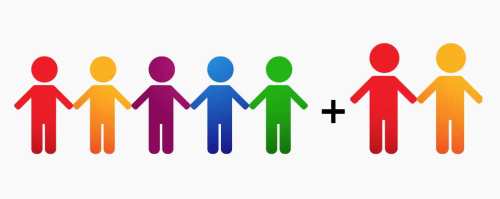 Beim morgendlichen Hundespaziergang begegne ich einer Frau mit einem Welpen und ich komme mit ihr ins Gespräch. Wir kennen uns seit Jahren und unterhalten uns über die Kinder, denn unsere Ältesten waren in einer Grundschulklasse. Insgesamt hat die Frau sieben Kinder und als sie zum Ende kommt, habe ich das Gefühl, kaum etwas über meine Zwei erzählen zu können. Nun, ich kann doch mitreden, denn ich selber bin eins von fünf Kindern. Auf dem Rückweg denke ich über diesen Beitrag nach, der ebenfalls von einer Familie mit fünf Kindern handeln soll. In meiner unmittelbaren Nachbarschaft wohnen noch einmal drei Familien mit vier bzw. fünf Kindern. So selten scheint es also gar nicht zu sein, dass sich Eltern entschließen, dem gängigen Bild der Familie mit einem oder zwei Kindern zu widersprechen.
Beim morgendlichen Hundespaziergang begegne ich einer Frau mit einem Welpen und ich komme mit ihr ins Gespräch. Wir kennen uns seit Jahren und unterhalten uns über die Kinder, denn unsere Ältesten waren in einer Grundschulklasse. Insgesamt hat die Frau sieben Kinder und als sie zum Ende kommt, habe ich das Gefühl, kaum etwas über meine Zwei erzählen zu können. Nun, ich kann doch mitreden, denn ich selber bin eins von fünf Kindern. Auf dem Rückweg denke ich über diesen Beitrag nach, der ebenfalls von einer Familie mit fünf Kindern handeln soll. In meiner unmittelbaren Nachbarschaft wohnen noch einmal drei Familien mit vier bzw. fünf Kindern. So selten scheint es also gar nicht zu sein, dass sich Eltern entschließen, dem gängigen Bild der Familie mit einem oder zwei Kindern zu widersprechen.
Ich mache mich schlau und finde verschiedene Zahlen. Im Schnitt sind es etwa 12 % der Familien, die in Deutschland als kinderreich, also mit drei und mehr Kindern, gelten. Dabei wird das Wort „kinderreich“ gerne vermieden, weil reich an Kindern oft mit wirtschaftlich schmalen Verhältnissen verbunden wird. Dies, weil man in den Köpfen davon aus geht, dass wenigstens ein Elternteil aufgrund der Kinderzahl nicht erwerbstätig sein kann. Der überzeugten Einzelkind-Mutter und anderen gelingt es kaum, die Vorstellung mit drei und mehr Kindern zu leben, nicht mit Stress, Chaos und viel Hausarbeit zu verbinden.
Stress erlebt sie nur durch die Lautstärke, wenn alle Kinder zuhause sind, sagt meine Interview-Mutter und fügt tröstlich dazu, dass das ja nur besser werden kann, je älter die Kinder werden. Die Ruhe am Vormittag täuscht. Sie sitzt mit mir entspannt bei einer Tasse Tee und erzählt aus dem Familienleben. Auf dem Schoß sitzt der jüngste Sohn. Entsprechend seines Sprachvermögens mit 9 Monaten beteiligt er sich lebhaft an der Unterhaltung. Ansonsten hat sie keinen Stress, denn es kommt ja sowieso so, wie es kommt und das muss man nehmen, wie es ist. Starke Worte, wenn man weiß, dass ab dem frühen Nachmittag Kind Nummer 2, 3, 4 und 5 nach Hause kommen. Dann ist es mit der Ruhe vorbei.
Die Alleinstellung der Familie kommt ihr lediglich ins Bewusstsein, wenn sie von anderen darauf angesprochen wird. Im normalen Alltag erlebt sie die Vielzahl der Familienmitglieder als Selbstverständlichkeit. Trotzdem nimmt sie wahr, dass die Menschen aufhorchen, wenn sie von fünf Kindern erzählt. Ob geplant oder nicht, der Vater ist eins von vier Kindern, die ebenfalls alle vier Kinder haben. Sie selber hatte früher die Vorstellung, einmal ein oder zwei Kinder zu bekommen. Die Reaktionen auf Schwangerschaften haben sich mit steigender Kinderzahl verändert. Von anfänglicher Begeisterung und Glückwünschen bis hin zu unpassenden Fragen, ob es nicht schon genug Kinder seien oder es ein Unfall ist, hat sie alles erlebt. Das Unverständnis mancher Leute, die Irritation und das Befremden, dass man gerne und bewusst mit vielen Kinder leben möchte, wird größer.
Vom frühen Nachmittag bis frühen Abend ist Kinderzeit in der Familie. Bis halb Acht fordern die Jüngeren Aufmerksamkeit, danach ist noch Raum für die Älteren, bis diese schlafen gehen. Der Vater steht mitten drin, unternimmt und spielt viel mit seinem Nachwuchs, redet und beschäftigt sich mit ihnen. Jedes Kind hat seine eigenen Nischen, über die es sich seine besondere Aufmerksamkeit holt. Sieht der Außenstehende fünf Kinder, lebt die Familie sehr bewusst mit den individuellen Eigenheiten jedes einzelnen und geht, wo möglich, darauf ein. Der Mutter ist durchaus bewusst, dass sie nur begrenzt erziehen kann. Eher versteht sie sich als Begleitung nach den persönlichen Stärken und Schwächen ihrer Kinder. Dennoch geben die Eltern den formenden Rahmen. Gemeinsame Mahlzeiten sind für große Familien ein Muss und so legt besonders der Vater Wert darauf, dass beispielsweise alle am Tisch sitzen und Essmanieren gewahrt bleiben. Rituale und Regeln dienen nicht allein dazu, das Familienleben zu ordnen und organisieren, sie sind auch zugleich ein probates Mittel, das Gemeinschaftsgefühl der Kinder untereinander zu stärken. Die Kinder wachsen einerseits mit der stets schützenden Gemeinschaft auf, in der Begriffe wie Rücksicht, Teilen, für die anderen mitdenken genauso bedeutend sind, wie die Selbstverständlichkeit, früh zu lernen, eigene Wege zu gehen und Eigenverantwortung zu übernehmen – immer die Familie im Rücken.
Die Mutter ist weit entfernt davon, die gängigen Vorstellungen einer Hausfrau mit fünf Kindern zu erfüllen. Ohne ihre Arbeit hätte sie keine fünf Kinder bekommen, sagt sie. Beim dritten Kind war sie ein Jahr lang zuhause und konnte kaum den Arbeitsbeginn erwarten. Einen Krankheitstag wegen krankem Kind hat sie noch nie einreichen müssen. War einmal ein Kind krank, war es immer möglich, den Dienst zu tauschen oder zu verschieben. Gute Organisation und ein starkes Netzwerk ist ohne Zweifel bei so einer großen Familie erforderlich, was aber mit der Zeit wächst. So lebt im gleichen Haus eine Familie mit drei Kindern. Ergeben sich Überschneidungen bei Terminen, ist es mittels Babyphone immer möglich, kleine Lücken zu überbrücken. Zusammengerechnet (einschließlich Arbeitszeit) verbucht die Mutter zwei Tage in der Woche ohne Kinderbetreuung für sich. Genug Zeit, um zu entspannen und eigenen Interessen, wie Sport und Treffen mit Freunden, nachzugehen.
Natürlich gehen manche Dinge nicht so leicht, wie in kleineren Familien. Wollen die Kinder Angebote nutzen und Vereinssport machen, müssen sie Angebote in unmittelbarer Umgebung suchen. Sie kann keinen Fahrdienst einrichten und so müssen manche Dinge warten bis die Kinder selber das öffentliche Verkehrsnetz nutzen können. Elternabende versucht sie zu besuchen. Dabei ist es ihr wichtig, der Lehrkraft oder Erzieherin ihre Wertschätzung durch ihr Interesse auszudrücken. Die Kinder suchen sich ihre Lücken, in denen sie ganz speziell für sich Zeit mit den Eltern finden. Alles andere wird halt gemeinsam gemacht.
Wo bleibt das Paar? An dieser Stelle lacht sie: Zeit für ihren Mann und sich ist hart erkämpfte Zeit. Zum Glück sei der Vater sehr kommunikativ und unterhaltsam, weshalb sie immer das Gefühl der Verbundenheit hat. Er würde durchaus einmal ein paar Tage wegfahren, die Kinderbetreuung organisieren und abschalten. Aber da gesteht sie ein, noch nicht soweit zu sein … der 9 Monate alte Sohn auf dem Schoß macht es deutlich.
Kinderreiche Familien empfinden sich selber als selbstverständlich und tatsächlich auch reich. Reich im Sinne der Gemeinschaft, nie alleine sein zu müssen und kennen selten das Gefühl der Langeweile. Die Eltern wachsen in diese Rolle in natürlicher Weise hinein, müssen ein hohes Maß an Flexibilität und Offenheit einbringen. Wo fünf Kinder zuhause sind, kommen oft Freunde dazu … macht ja auch nichts – es kommt ja sowieso so, wie es kommen muss.
 Ein Beitrag aus dem Magazin „Im Mittelpunkt“ Januar/Februar 2017 mit dem Leitthema „Eltern“
Ein Beitrag aus dem Magazin „Im Mittelpunkt“ Januar/Februar 2017 mit dem Leitthema „Eltern“
Das ganze Magazin kann als eBook oder interaktives Pdf heruntergeladen werden. Die gedruckte Version, einschließlich dem Einleger mit allen Veranstaltungen, bekommt man in den Einrichtungen des Stadtteilzentrum Steglitz e.V.







