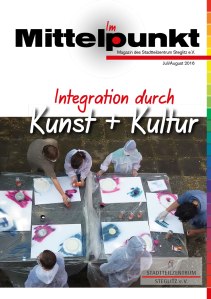Der Raum füllt sich mit immer mehr Besuchern, aufgeregte Stimmen sind hinter dem Vorhang zu hören, alle suchen sich einen Platz, es wird dunkel, leise und die Vorstellung beginnt. Ein erstes Musikstück ist zu hören, das sich in der Folge mit vielen anderen Stücken zu einem Musical verbindet. Kinder spielen ihre Instrumente, singen und tanzen, verlieren ihre Nervosität und dürfen schließlich im begeisterten Beifall der Zuschauer versinken. Der Erfolg hat dem wochenlangen Proben recht gegeben. Die ErzieherInnen im Kinder- und Jugendhaus haben mit den Kindern ein Stück einstudiert. Sie haben selber Texte geschrieben, Melodien komponiert, dazu gesungen, immer wieder verbessert und geprobt. Eine andere Gruppe von Kindern hat Tänze einstudiert, Kostüme entworfen und genäht, ein Bühnenbild ist entstanden und schließlich die Plakate, die zum Musical eingeladen haben. Ist die Vorstellung vorbei, ist kaum mehr nachzuvollziehen, wie viel Arbeit es war, alles auf die Beine zu stellen. Die Kinder haben auf mehreren Ebenen Dinge gelernt und erfahren, deren Tragweite sie in jungen Jahren noch nicht absehen können. Der Transporteur war die gemeinsame Kunst.
Eine umfassende Definition zu geben, was Kunst ist, fällt schwer, weil der Facettenreichtum des Begriffs kaum zu fassen ist. Einigkeit dürfte darüber herrschen, dass immer ein Prozess damit verbunden ist, der dem Kunstschaffenden die Möglichkeit gibt, Gefühle und Gedanken zu offenbaren und zum Ausdruck zu bringen. Der Kunstschaffenden gibt seine Botschaft mit seinen Ausdrucksmitteln an andere weiter und damit einen Teil von sich selbst. Unbedeutend, ob er das bewusst oder unbewusst tut, denn wie es beim Betrachter ankommt und verstanden wird, hat er nicht in der Hand. Die Möglichkeiten, die der Kunstschaffende hat, sind nahezu unbegrenzt. Kunst bricht Regeln, setzt Bekanntes und Gewohntes außer Kraft. Kunst provoziert und bedient sich endloser Fantasien. Kunst darf nahezu alles, was der Mensch in seiner Vorstellungskraft sicht- und hörbar machen kann. Die reine Kunst ist frei.
Kunst wird gerne mit dem Begriff Kultur verbunden, was sofort eine massive Einschränkung der reinen Kunst bedeutet. Kultur ist ein stets gesellschaftlich geprägtes Verständnis, dass von Zeit, Mode und Historie der jeweiligen Gesellschaft vorgegeben ist. Kultur ist, was gefällt und zeitgemäß empfunden wird. Die Gesellschaft gibt vor, welche Art der Musik, bildenden und darstellenden Kunst und der Literatur Erfolg oder eben auch nicht haben kann. Kultur verändert sich.
Kunst und Kultur setzen menschliches Handeln voraus. Setzt man nun die Begriffe Kunst mit „Prozess“ und Kultur mit „gesellschaftlicher Veränderung“ gleich, liegt der Rückschluss nicht fern, dass Kunst und Kultur auch den Kunstschaffenden selber verändert. Dieser Veränderungsprozess ist das Mittel, mit dem Kunst und Kultur in pädagogischen, psychologischen und sozialen Zusammenhängen genutzt wird. PädagogInnen, TherapeutInnen und ErzieherInnen nutzen Kunst und Kultur, um gewünschte und verändernde Inhalte bewusst zu machen.
In einer Kita wird ein Märchen vorgelesen, das Stück mit den Kindern geprobt, vertont und auf einer CD verewigt. Die Kinder lernten eine Geschichte in eigenen Worten wieder zu geben, wie Geräusche entstehen und welche Arbeit in einer CD steckt. In einer Schülerbetreuung wird ein Papierprojekt durchgeführt, um den Kindern bewusst zu machen, welche Umweltressourcen genutzt und verbraucht werden, um Papier zu erzeugen. Die dabei entstehenden künstlerischen Arbeiten sind Mittel zum Zweck, die letztlich viel Stolz vermitteln und im Gedächtnis haften bleiben. Jugendliche werden animiert, aus altem Zeitungspapier ihre Trauminsel zu bauen, und machen so die ganz neue Erfahrung, dass auch sie sehr kreativ sein können. Zahllos sind die Beispiele, bei denen etwas mit Kindern zusammen gebaut, gemalt, geprobt oder gespielt wird. Sinn ist es, immer die freie Fantasie zu nutzen und deren Potential zu entfalten. Bewusst ist dabei, dass Menschen mit viel Fantasie Zusammenhänge neu kombinieren und gewohnte Muster aufbrechen können. Neue Lösungen entstehen, die einen gewünschten Fortschritt erzielen können. Ein Kind, das mit Behinderungen lebt, malt mit einem Pinsel nicht nur, es macht Sinneserfahrungen und kann sich selber wahrnehmen. Schüchterne Kinder legen im Theaterspiel ihre Scheu ab und stärken das Selbstbewusstsein. Junge Erwachsene, die den Kunstunterricht immer langweilig fanden, machen in der Gruppe die Erfahrung, wie viel Kreativität in ihnen steckt.
Die künstlerischen Prozesse, die im pädagogischen Zusammenhang genutzt werden, sind frei von Bewertung und Talent. Es geht um den Prozess an sich selbst und nicht darum ein Kunstwerk zu schaffen. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass ein Talent entdeckt wird, das dann in gezielte Förderung vermittelt werden muss. Bewertet werden kann nur, ob ein Projekt oder Prozess erfolgreich war und angenommen wurde. Ob ein Bild, das von einem Jugendlichen gemalt wurde, schön ist, ist nicht von Bedeutung. Wichtig ist, dass es gemalt wurde. Ist es schön geworden, umso besser, weil er oder sie dann weiter machen.
So ist es nicht weiter verwunderlich, dass gerade in sozialen Einrichtungen zahlreiche Angebote zu finden sind, die Kunst und Kultur zum Inhalt haben. Malgruppen für Erwachsene, Tanz- und Theatergruppen, Literaturkreise oder Musikangebote stehen immer dort auf dem Programm, wo Menschen zusammen kommen. Austausch und Kommunikation stehen hier im Fokus. In der Gruppe können Menschen etwas bewerkstelligen und die Stillen in etwas einbezogen werden, was sie sonst als Zuschauer betrachten würden. Kunst und Kultur in sozialen Einrichtungen bewegt und verbindet. Die KünstlerInnen, die hier zu sehen sind, sind nicht die der großen Bühnen und Öffentlichkeit. Es sind die Senioren, die nicht allein sein wollen, Geflüchtete, die ihrem Erlebten Ausdruck vermitteln möchten und Menschen aus der Nachbarschaft, die in der Gruppe Dinge mitmachen, zu denen ihnen alleine der Antrieb fehlt. Kunst in sozialen Einrichtungen verbindet – der begeisterte Beifall aller Beteiligten heißt dabei jeden willkommen.
Dies ist einer von vielen schönen Beiträgen zum Thema „Integration durch Kunst und Kultur“ und zu finden sind sie alle im Magazin „Im Mittelpunkt“ des Stadtteilzentrum Steglitz e.V. oder hier:
Als eBook – eine epub-Datei, als interaktives Pdf und den Einleger „Mittendrin“ mit Veranstaltungen und Ferientipps des Stadtteilzentrum im Juli und August.
http://www.stadtteilzentrum-steglitz.de/ebook/MagazinImMittelpunktJuliAugust2016.epub – 230 MB
http://www.stadtteilzentrum-steglitz.de/ebook/MagazinImMittelpunktJuliAugust2016.pdf – 230 MB
http://www.stadtteilzentrum-steglitz.de/ebook/VeranstaltungenSzSMittendrinJuliAugust2016online.pdf – 640 KB